 Seit dieser Woche ist er in den Buchhandlungen, mein Roman über Margarethe Krupp und die Gründung der Margarethenhöhe: „Die Königin von der Ruhr“, der bei Lübbe erschienen ist. Ich bin wie bei jedem neuen Buch ziemlich aufgeregt und freue mich gleichzeitig wie Bolle. Wie ich auf die Idee kam, über Margarethe Krupp (1854-1931) zu schreiben, weiß ich nicht mehr. Ich glaube, mich hat interessiert, woher die Margarethenhöhe ihren Namen hat und war erstaunt, dass die Gartenstadt in Essen nicht nur nach Margarethe Krupp benannt wurde, sondern dass diese auch Initiatorin der Siedlung war.
Seit dieser Woche ist er in den Buchhandlungen, mein Roman über Margarethe Krupp und die Gründung der Margarethenhöhe: „Die Königin von der Ruhr“, der bei Lübbe erschienen ist. Ich bin wie bei jedem neuen Buch ziemlich aufgeregt und freue mich gleichzeitig wie Bolle. Wie ich auf die Idee kam, über Margarethe Krupp (1854-1931) zu schreiben, weiß ich nicht mehr. Ich glaube, mich hat interessiert, woher die Margarethenhöhe ihren Namen hat und war erstaunt, dass die Gartenstadt in Essen nicht nur nach Margarethe Krupp benannt wurde, sondern dass diese auch Initiatorin der Siedlung war.
Es war gar nicht so leicht, mehr über sie zu erfahren, in Büchern über das Unternehmen Krupp taucht sie oft nur am Rande auf. Dabei hat sie nach dem Tod ihres Mannes von 1902 bis 1906 vier Jahre das Unternehmen als Treuhänderin ihrer minderjährigen Tochter Bertha das Unternehmen geleitet. Das ist in dem Roman ebenso Thema wie die Gründung der Margarethenhöhe, für die sie am Tag der Hochzeit ihrer Tochter eine Stiftung ins Leben gerufen hat.
Der Roman orientiert sich an historischen Daten, aber er erzählt auch, wie ich mir das Leben der Frau vorgestellt habe. Im Historischen Krupp-Archiv in Essen und im Landesarchiv Sachsen-Anhalt in Wernigerode habe ich unzählige Fotos, Briefe, Dokumente und sogar eine mit Margarethe Krupp erstellte Biografie gesichtet. Aber natürlich wollte ich auch eine spannende Geschichte schreiben, für die ich mir zum Glück für mich, zum Leid von Margarethe Krupp keine Hindernisse ausdenken musste.
Birgit Ebbert: Die Königin von der Ruhr. Lübbe 2023
Pressereaktionen
Margarethe Krupp – eine Muster-Ahnfrau der Emanzipation? (NRZ 09.12.2023)
Die Königin von der Ruhr (Radio Hagen 21.11.2023)
Recherche-Besuch in der Margarethenhöhe
Und dann hatte ich in meinem alten Blog über meinen ersten Besuch in der Margarethenhöhe im Juli 2021 gebloggt:
Während ich an einigen Studienheften arbeite, denke ich schon daran herum, was wie und wo ich über das Ruhrgebiet schreiben könnte. Da kam die Information, dass das Ruhrmuseum eine Führung durch die Margarethenhöhe in Essen anbot, genau richtig. Die wollte ich immer schon anschauen, also habe ich mich spontan angemeldet und hatte das Glück, dass es außer mir nur eine weitere Teilnehmerin gab und wir eine individuelle Führung bekamen, bie der niemand drängelte und Corona-Abstand immer möglich war.
Mein erster Eindruck von der Margarethenhöhe
 Die Führung begann erst einmal mit einem leisen Tadel des Stadtführers, als er meinte, die Margarethenhöhe würde fälschlicherweise immer als „Arbeitersiedlung“ bezeichnet, was so nicht stimme. Tja, hätte ich schon im letzten April, als ich an meinem Buch „Das gibt’s nur im Ruhrgebiet“ eine Führung besuchen können, hätte ich das in meinem Artikel über die Arbeitersiedlungen berücksichtigen können
Die Führung begann erst einmal mit einem leisen Tadel des Stadtführers, als er meinte, die Margarethenhöhe würde fälschlicherweise immer als „Arbeitersiedlung“ bezeichnet, was so nicht stimme. Tja, hätte ich schon im letzten April, als ich an meinem Buch „Das gibt’s nur im Ruhrgebiet“ eine Führung besuchen können, hätte ich das in meinem Artikel über die Arbeitersiedlungen berücksichtigen können 

Die Geschichte der Margarethenhöhe
 Die Margarethenhöhe wurde gestiftet von Margarethe Krupp, der Witwe von Friedrich Krupp, die einige Jahr auch als gesetzliche Vertreterin ihrer minderjährigen Tochter Bertha, die das Unternehmen Krupp 1902 geerbt hatte, an der Spitze des Unternehmens stand. Am Tag der Hochzeit ihrer Tochter, an dem diese bzw. ihr Mann gleichzeitig Chef des Krupp-Imperiums wurden, gründete Margarethe Krupp die Stiftung, die bis heute Inhaber der Häuser auf der Margarethenhöhe ist. Die Häuser im Grünen wurden zum Teil an MitarbeiterInnen des Unternehmens und zum Teil an BürgerInnen der Stadt Essen vermietet. Architekt Georg Metzendorf hatte den Auftrag wohl auch deshalb bekommen, weil er das Modell eines praktikablen und ansehnlichen Arbeiterwohnhauses entwickelt und gebaut hatte, das modern und kostensparend war. Bereits damals gab es in den Häusern ein WC und teilweise ein gesondertes Bad, vor allem aber war die Küche so konstruiert, dass der Herd zugleich als Zentralheizung fungierte und auch die anderen Räume der Wohnung wärmte. Obwohl die Häuser alle dem gleichen Grundriss und Prinzip entsprachen, wirken sie noch heute unterschiedlich, mal sind die Fenster anders, mal die Türen, mal unterscheiden sie sich in den Dachgauben. Wirklich spannend durch die Siedlung zu gehen, die auch als eine der ersten Gartenstädte in Deutschland gesehen wird. Ob sie das wirklich ist, hängt von der Definition der Gartenstadt ab. Anfang des letzten Jahrhunderts gab es eine Gartenstadt-Bewegung, Genossenschaften bauten Siedlungen, die ein naturnahes Wohnen im Vergleich zu den üblichen beengten Wohnverhältnissen ermöglichen sollte. Die Margarethenhöhe ist keine Genossenschaft, sondern wurde von einer Unternehmerin gestiftet und in ihrer Gestaltung und konzeptionellen Ausrichtung mitbestimmt. Immerhin hat sie sich das einiges kosten lassen und später zusätzlich 50 Hektar Land neben der Siedlung gestiftet, das nicht bebaut werden, sondern nur als Erholungsfläche genutzt werden durfte. Diesen Teil habe ich noch gar nicht angeschaut, weil am Tag der Führung Unwetter angesagt war, da habe ich dann lieber das erste Eis seit fast einem Jahr im Freien genossen
Die Margarethenhöhe wurde gestiftet von Margarethe Krupp, der Witwe von Friedrich Krupp, die einige Jahr auch als gesetzliche Vertreterin ihrer minderjährigen Tochter Bertha, die das Unternehmen Krupp 1902 geerbt hatte, an der Spitze des Unternehmens stand. Am Tag der Hochzeit ihrer Tochter, an dem diese bzw. ihr Mann gleichzeitig Chef des Krupp-Imperiums wurden, gründete Margarethe Krupp die Stiftung, die bis heute Inhaber der Häuser auf der Margarethenhöhe ist. Die Häuser im Grünen wurden zum Teil an MitarbeiterInnen des Unternehmens und zum Teil an BürgerInnen der Stadt Essen vermietet. Architekt Georg Metzendorf hatte den Auftrag wohl auch deshalb bekommen, weil er das Modell eines praktikablen und ansehnlichen Arbeiterwohnhauses entwickelt und gebaut hatte, das modern und kostensparend war. Bereits damals gab es in den Häusern ein WC und teilweise ein gesondertes Bad, vor allem aber war die Küche so konstruiert, dass der Herd zugleich als Zentralheizung fungierte und auch die anderen Räume der Wohnung wärmte. Obwohl die Häuser alle dem gleichen Grundriss und Prinzip entsprachen, wirken sie noch heute unterschiedlich, mal sind die Fenster anders, mal die Türen, mal unterscheiden sie sich in den Dachgauben. Wirklich spannend durch die Siedlung zu gehen, die auch als eine der ersten Gartenstädte in Deutschland gesehen wird. Ob sie das wirklich ist, hängt von der Definition der Gartenstadt ab. Anfang des letzten Jahrhunderts gab es eine Gartenstadt-Bewegung, Genossenschaften bauten Siedlungen, die ein naturnahes Wohnen im Vergleich zu den üblichen beengten Wohnverhältnissen ermöglichen sollte. Die Margarethenhöhe ist keine Genossenschaft, sondern wurde von einer Unternehmerin gestiftet und in ihrer Gestaltung und konzeptionellen Ausrichtung mitbestimmt. Immerhin hat sie sich das einiges kosten lassen und später zusätzlich 50 Hektar Land neben der Siedlung gestiftet, das nicht bebaut werden, sondern nur als Erholungsfläche genutzt werden durfte. Diesen Teil habe ich noch gar nicht angeschaut, weil am Tag der Führung Unwetter angesagt war, da habe ich dann lieber das erste Eis seit fast einem Jahr im Freien genossen
Ein Rundgang durch die Margarethenhöhe
 Unsere Führung begann an dem Torbogen am Beginn der Steilen Straße. Wenn man von der gegenüberliegenden Brücke kommt, könnte man denken, man führe auf ein Schloss zu, weil es einige Stufen hinaufgeht, die rechts und links mit Blumenkübeln begrenzt sind –
Unsere Führung begann an dem Torbogen am Beginn der Steilen Straße. Wenn man von der gegenüberliegenden Brücke kommt, könnte man denken, man führe auf ein Schloss zu, weil es einige Stufen hinaufgeht, die rechts und links mit Blumenkübeln begrenzt sind – 
 Im Rahmen der Führung hatten wir Gelegenheit, eine Musterwohnung zu besuchen, die mir auch gefallen hätte – man schaute in einen kleinen Garten, der auch beim Aufbau der Siedlung nur als Ziergarten genutzt werden durfte, weil die Menschen sich hier erholen sollten. Zu dem Museum gehörten ursprünglich auch Werkstätten und Atelierhäuser, von denen allerdings nur das kleine Atelierhaus den Krieg überlebt hat, dort befindet sich eine kleine Ausstellung über die Geschichte der Margarethenhöhe und die Kunst, die dort entstand. Ein wirklich spannender Rundgang mit Facetten der Kultur- und Industriegeschichte, den ich sicher noch einmal wiederholen werde. Das Ruhrmuseum bietet diese Führungen immer wieder an, ein Blick in den Veranstaltungsplan lohnt sich. Und was ich mit meinen Erkenntnissen mache, berichte ich dann irgendwann mal, wenn die Studienhefte fertig sind und ich wieder Platz im Kopf habe für ein neues Projekt
Im Rahmen der Führung hatten wir Gelegenheit, eine Musterwohnung zu besuchen, die mir auch gefallen hätte – man schaute in einen kleinen Garten, der auch beim Aufbau der Siedlung nur als Ziergarten genutzt werden durfte, weil die Menschen sich hier erholen sollten. Zu dem Museum gehörten ursprünglich auch Werkstätten und Atelierhäuser, von denen allerdings nur das kleine Atelierhaus den Krieg überlebt hat, dort befindet sich eine kleine Ausstellung über die Geschichte der Margarethenhöhe und die Kunst, die dort entstand. Ein wirklich spannender Rundgang mit Facetten der Kultur- und Industriegeschichte, den ich sicher noch einmal wiederholen werde. Das Ruhrmuseum bietet diese Führungen immer wieder an, ein Blick in den Veranstaltungsplan lohnt sich. Und was ich mit meinen Erkenntnissen mache, berichte ich dann irgendwann mal, wenn die Studienhefte fertig sind und ich wieder Platz im Kopf habe für ein neues Projekt 
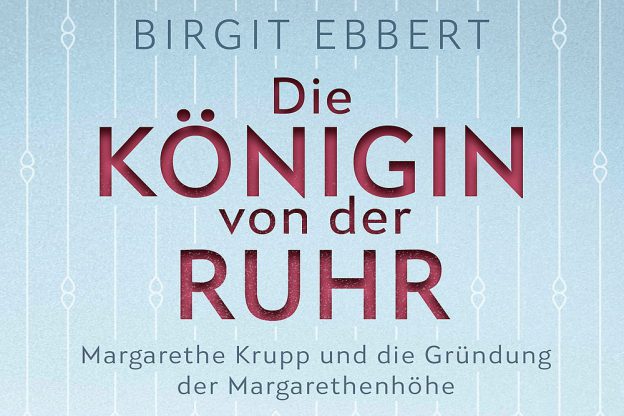

Pingback: Helene Leven-Intze - die vergessene Bildhauerin - Vergessene Frauen
Pingback: Margarethe Krupp (1854-1931) – Gründerin der Margarethenhöhe - Vergessene Frauen